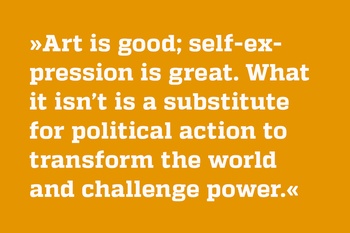
Filmemacher Adam Curtis über die Gefahren der gegenwärtigen Begeisterung für Expressivität und Individualismus.
Über die schlechten Verdienstaussichten für Absolventen von deutschen Kunsthochschulen berichtet Larissa Kikol in ihrem Artikel für Spiegel Online. "Top-Noten im Studium, hinterher Hartz IV", so lautet dessen polemische Überschrift. Fast interessanter als der Artikel selbst sind die Leserkommentare darunter – selten bekommt man einen derart kompakten Überblick über die verschiedenen Ressentiments gegen Kunst und Künstlern im Allgemeinen sowie die Kunstausbildung im Besonderen. Vor allem für Art Professionals ein empfehlenswerter Blick über den Tellerrand der eigenen Blase.
"Endlich mal wieder nichts verstehen" – so lautet der Slogan einer Werbekampagne für den Hamburger Kunstverein, welche der Institution neue Mitglieder bescheren soll. Marija Salomé Petrovic kritisiert in ihrem Artikel für das Magazin Dare nicht nur die Tatsache dass die verantwortliche Agentur Fotos von Ausstellungsbesuchern ohne deren Einverständnis verwendete, sondern problematisiert auch das durch die Kampagne vermittelte Selbstverständnis des Kunstvereins: "[...] wenn Unverständnis die einzige Erfahrung ist, die der durchschnittliche Besucher aus dem Besuch einer Ausstellung im Kunstverein mitnehmen kann, drängt sich die Frage auf, ob der Kunstverein nicht an seiner Vermittlung arbeiten sollte […] Anstatt Türen zu öffnen, funktioniert der ironisch provokative Ton der Kampagne eher als kleiner Schulterklopfer innerhalb des Zirkels derer, die sich selbst als bereits verständig bezeichnen würden."
Adam Curtis ist bekannt für seine Essay- und Dokumentarfilme, die er seit über 20 Jahren vor allem für die Britische BBC produziert. Anlässlich seines neuesten Films "HyperNormalisation" (verfügbar auf Youtube ) hat die Website The Creative Independent Auszüge aus einem Interview mit Curtis veröffentlicht, in dem er einige seiner Thesen zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Trends erläutert. Ein großes Problem sieht er in der aktuellen Begeisterung für das expressive Subjekt und damit einhergehend für dessen prototypische Verkörperung, den Künstler: "Art is good; self-expression is great. What it isn’t is a substitute for political action to transform the world and challenge power [...] It’s not to say you can’t make art if you want to do it, but it’s not the radical outsider. It’s not the hipster cool outsider. It’s everything. It’s conformity."
Die wohl größte Kontroverse der letzten zwei Wochen entzündete sich an einem Gemälde der Künstlerin Dana Schutz, welches im Rahmen der kürzlich eröffneten Whitney Bienniale in New York zu sehen ist. Das Gemälde mit dem Titel "Open Casket" ("Offener Sarg") zeigt den toten Körper eines afroamerikanischen Jungen, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist, da Schutz an dessen Stelle ungegenständliche Pinselstriche aufgetragen hat. Tatsächlich handelt es sich um die Interpretation eines ikonischen Fotos, welches enorme Bedeutung für die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA hatte. Es zeigt den vierzehnjährigen Emmett Till in einem offenen Sarg, sein Gesicht völlig entstellt durch den Lynchmord zweier weißer Amerikaner. Kurz nach der Ausstellungseröffnung stellte sich der Künstler Parker Bright, selbst Afroamerikaner, vor das Bild, während er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Black Death Spectacle" trug. Wenig später veröffentlichte die Künstlerin Hannah Black einen offenen Brief, in dem sie die Kuratoren der Ausstellung dazu auffordert, das Bild aus der Ausstellung zu entfernen und anschließend für dessen Zerstörung zu sorgen, so dass es weder auf den Kunstmarkt noch in ein Museum gelangen könne. Die Künstlerin habe als Weiße kein Recht, Schwarzes Leid in Profit und Spaß zu verwandeln.
Das komplette Statement als auch die Antwort der beiden Kuratoren kann man auf Artnet.news.com nachlesen, ebenso wie eine Zusammenfassung der verschiedenen Standpunkte, welche sich in den letzten Tagen in den Sozialen Netzwerken herausbildeten. Einen sehr guten Diskussionsbeitrag hat auch Klaus Speidel für das Magazin Spike verfasst.
Wie der politische Widerstand gegen die Präsidentschaft Donald Trumps kommerzialisiert wird, beschreibt Amanda Hess in ihrem Bericht für die New York Times. Sie erläutert anhand zahlreicher - zum Teil wirklich grotesker - Beispiele, wie feministische und antirassistische Forderungen Einzug halten in die strategische Markenkommunikation. Neu sei dieser Trend nicht, so die Autorin: "Companies have long marketed their wares around causes; by raising awareness about some issue, they lift their brand names, too. Those campaigns have typically focused on safely nonpartisan matters, like curing cancer or 'empowering women'. […] But when it comes to viral marketing, the resistance is hot right now."
Bildende Künstler stehen hin und wieder vor der Herausforderung, die eigene Arbeit in einem Artist Statement erklären zu müssen. Dass die sprachliche Reflexion über die meist praktische und oft intuitive Arbeit nicht allen leicht fällt, scheint einleuchtend. Artspace.com hat nun einen Leitfaden veröffentlicht, der Künstlern nicht nur wirklich sinnvolle Tipps gibt, sondern auch amüsant geschrieben ist. Einer der wichtigsten Hinweise: "Your Love for Making Art Doesn’t Justify its Worth".
Yung Hurn, Rapper aus Wien, und Malerstar Daniel Richter haben sich getroffen um zusammen ein Bild zu malen und über Kunst zu sprechen. Dieses vom INDIE Magazin und Nike gesponsorte Treffen wurde auf Video festgehalten und ist u.a. hier auf Youtube zu sehen. Leider ist das Ergebnis weder richtig lustig noch besonders erkenntnisreich. Vor allem Herr Hurn scheint merkwürdig angespannt und so wird das lockere Treffen schnell zur Fremdschämnummer.
Künstlerin Yayoi Kusama ist bekannt für spektakuläre Rauminstallationen, die äußerst fotogen sind. Das Hirshhorn Museum in Washington hat der der Japanerin eine Ausstellung gewidmet, die nun von Besuchern förmlich überrannt wird. Stundenlanges Anstehen und eine Aufenthaltsdauer pro Raum von maximal 30 Sekunden seien die Folge, so Emily Palmer in ihrem Erlebnisbericht, den sie für die New York Times verfasst hat. Der perfekte Alptraum eines Museumsbesuchs, getragen von der vagen Hoffnung auf ein spektakuläres Selfie.