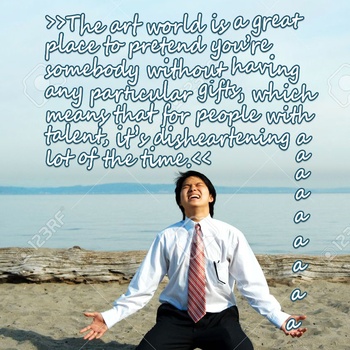
Der neue Chefredakteur des Kunstmagazin Artforum in einem Interview, veröffentlicht auf ssense.com.
Wer als freischaffende Künstlerin bzw freischaffender Künstler schon einmal staatliche Fördergelder oder Projektzuschüsse betragt hat, der weiß, wie erstaunlich inkompatibel die Struktur der eigenen Arbeit mit den Förderbedingungen sein kann. Häufig wird verlangt, detaillierte Pläne vorzulegen für Zeiträume, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch gar nicht zu überblicken sind. Zusätzlich müssen meist Eigenmittel nachgewiesen werden, was für Institutionen mit festem Budget kein Problem ist, für Freischaffende allerdings schon. Petra Kohse beschreibt in ihrem Artikel für die Berliner Zeitung die aus ihrer Sicht unnötig bürokratischen Mechanismen der Mittelverteilung und fragt: "Welche Impulse sind von Künstlern zu erwarten, die ihr Leben nach den Antragsfristen der Fonds takten, ihre Arbeit nach den Moden der jeweiligen Förderinstitutionen ausrichten und sich in Buchhaltung zermürben, statt das zu tun, was sie möglicherweise können?"
Über die verheerenden Folgen des Opioid-Missbrauchs in Teilen der nordamerikanischen Mittelschicht ist in den letzten Wochen auch in deutschen Medien viel berichtet worden. In der Kunstpresse ausführlich thematisiert wurde das Mäzenatentum der US-Amerikanischen Unternehmerfamilie Sackler, welche einen Großteil ihres riesigen Vermögens mit dem Verkauf von opiumbasierten Schmerzmitteln machte. Anfang des Jahres hat die berühmte Foto-Künstlerin Nan Goldin ihre eigene Schmerzmittelabhängigkeit öffentlich gemacht, welche sie inzwischen überwunden hat. Nun hat Goldin eine Gruppe namens P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) gegründet, um die Familie Sackler und ihr Pharma-Imperium unter Druck zu setzen, wie unter anderem artlyst.com berichtet. "'To get their ear we will target their philanthropy […] They have washed their blood money through the halls of museums and universities around the world. We demand that the Sacklers and Purdue Pharma use their fortune to fund addiction treatment and education. There is no time to waste,'" so Goldin in einem Essay, welches unter anderem auf artforum.com veröffentlich wurde.
Thomas Kliemann hat für den Bonner General-Anzeiger das aktuelle Buch der Kunsthistorikerin Anne-Marie Bonnet gelesen und fasst in seinem Artikel ihre wichtigsten Thesen zusammen. "Was ist zeitgenössische Kunst oder Wozu Kunstgeschichte?" heißt der 104 Seiten schmale Band, in welchem Bonnet der eigenen Disziplin und damit auch den Kunstmuseen einen allgemeinen Bedeutungsverlust zu unterstellen scheint. Kliemann schreibt: "Die Kunstgeschichte als Disziplin, die die Kunst zu erforschen, zu klassifizieren, einzuordnen und zu bewerten hat, kommt als Player [...] ähnlich schlecht weg wie die Museumslandschaft, die als Regulativ, als kritische Instanz teilweise versagt."
Die kommende Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst, welche Anfang Juni beginnen soll, wird von Gabi Ngcobo aus Johannesburg geleitet. Mit ihren vier Co-Kuratoren Thiago de Paula Souza, Nomaduma Rosa Masilela, Yvette Mutumba und Moses Serubiri solle allerdings keine Ausstellung mit dem expliziten Schwerpunkt "Afrika" entstehen, so Mutumba gegenüber SZ-Redakteur Jonathan Fischer. "Tatsächlich zitiert der Biennale-Titel nicht etwa einen südafrikanischen Dichter sondern Tina Turners 'We Don't Need Another Hero', und der Pressetext erwähnt kein einziges Mal die Wörter 'Afrika' oder 'postkolonial'", so Fischer in seinem Artikel mit dem etwas merkwürdigen Titel "Kunst ist das neue Schwarz". "Ganz bewusst, sagt Mutumba, denn wie könnte man subtile rassistische Vorurteile besser entlarven, als gewisse Erwartungen zu enttäuschen? Dafür brächten die Kuratoren der Biennale ihre Diskurse mit, man werde Machtpositionen mit Gegen-Narrativen herausfordern. Wenn deswegen mehr Künstler aus Afrika und der afrikanischen Diaspora mitwirken würden als je zuvor, sei das nur Folgeeffekt."
"Pop Art: Icons that Matter" hieß eine Ausstellung im Pariser Museum Musée Maillol, welche am vergangenen Sonntag auslief. Joseph Nechvatal nutzt seine Ausstellungsbesprechung für hyperallergic.com für eine Generalabrechnung mit der Pop-Art aus polit-aktivistischer Perspektive. Nechvatal schreibt: "[...] Pop Art did not then, and does not now, matter — because it has never been a site of cultural resistance. (Being ironic does not make a difference.) Rather, American Pop Art has been a scene of authoritarianism rooted in an affirmation of top-down corporate affluence. As such, it is zombie representational, and there is no need to imaginatively interact with most of it." Klassische Pop Art sei eine Domäne weißer Männer, häufig sexistisch und im Vergleich zur zeitgleich produzierten Popmusik der 60er Jahre deutlich weniger divers und progressiv. Aus gesellschaftspolitischer Sicht scheinen einige Aspekte der Pop-Art aus heutiger Perspektive in der Tat fragwürdig, allerdings greift der argumentative Ansatz des Autors etwas zu kurz. Das ethisch-moralisch Erwünschte als wichtigstes Kriterium zur Bewertung von Kunst heranzuziehen scheint mir eine unnötige Einschränkung des Nachdenkens über Kunst zu sein.
„Regelmäßig warnt die Polizei vor einer üblichen Betrugsmasche: Menschen wird ein Gewinn in Aussicht gestellt, für die Auszahlung sollen sie aber erstmal eine „Gebühr“ bezahlen. Von der zuvor versprochenen Summe sehen sie allerdings nie auch nur einen Cent. So ähnlich scheint auch das Geschäftsmodell des „Kunstverein Art-Projekt Worpswede-Deutschland e.V.“ (APWD) zu funktionieren.“ So beginnt ein Bericht des Journalisten Lars Fischer über die merkwürdigen Vorgänge rund um die Vergabe eines hoch dotierten Kunstpreises. Die Ergebnisse von Fischers Recherche zu diesem kuriosen Betrugsfall (?) kann man auf der Homepage der Wümme Zeitung nachlesen.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf die Zwillingsreiter der Kunstapokalypse – die Kaplan Twins. Die beiden haben an der NYU Kunst studiert und sind mit gemalten Pornostills und Nacktselfies bekannt geworden. Die aggressive Vermarktung ihrer Sexyness hat sie inzwischen zu Celebrities gemacht. Natürlich soll das ganze eine Provokation sein und durchaus auch reflexiv, aber als mediale "Performance" bleibt es dann doch zu stumpf um wirklich nachhaltig interessant zu sein.
Dazu passt ein Artikel aus der New York Times, der sich mit der Strategie des „Self-Branding“ beschäftigt, welche sich in den 90er Jahren durchzusetzen begann.