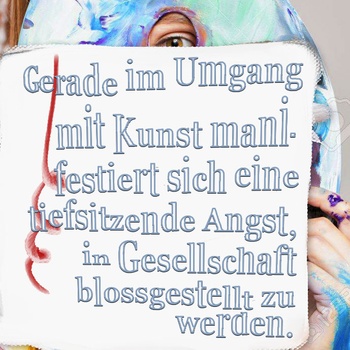
Zitat der Woche aus einem Artikel von Christian Saehrendt, erschienen in der NZZ vom 04.02.2018.
Ein Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer aus dem Jahre 1950 hat in Berlin für heftigen Streit gesorgt. Das an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule angebrachte Stück Konkreter Poesie mit dem Titel "Avenidas" ("Alleen") lautet aus dem Spanischen übersetzt: "Alleen / Alleen und Blumen // Blumen / Blumen und Frauen // Alleen und Blumen und Frauen und / ein Bewunderer." Ein Teil der Studentenschaft empfand die Art der Kontextualisierung von Frauen innerhalb des Gedichts als tendenziell herabwürdigend und forderte die Entfernung der Wandarbeit. Andere sahen nun die Kunst- und Meinungsfreiheit in Gefahr und setzten sich für den Erhalt des Gedichtes ein. Nach fast zwei Jahren Streit wurde nun beschlossen das Gedicht im Herbst diesen Jahres durch eine Arbeit der Lyrikerin Barbara Köhler, Poetikpreisträgerin des Jahres 2017, zu ersetzen. An die Debatte um Gomringers Gedicht soll dann ein Schild erinnern. Ab sofort soll die Fassade der Hochschule regelmäßig mit einem Werk des jeweiligen Preisträgers bzw. der jeweiligen Preisträgerin ausgestattet werden. Lothar Müller kritisiert in seinem Artikel für die Süddeutsche Zeitung die Entscheidung des Akademischen Senats der Hochschule als Ausweichmanöver: "[…] es ersetzt die Attacke auf das Gedicht, gegen die sich ästhetisch oder politisch argumentieren ließ, durch ein neues Regelwerk, in dem das anstößige Gedicht gewissermaßen aus Routine verschwindet, ohne dass von seiner Anstößigkeit noch groß die Rede ist."
In den letzten Monaten hat sich die Zahl der Künstler, denen Machtmissbrauch vorgeworfen wird, stetig erhöht. Institutionen reagieren unterschiedlich auf die Vorwürfe – manche Museen haben geplante Ausstellungen mit beschuldigten Künstlern abgesagt, andere versuchen durch kuratorische Ergänzungen die Arbeit der jeweiligen Künstler mit den Vorwürfen in Beziehung zu setzen. Christine Käppeler plädiert in ihrem Kommentar für den Freitag dafür, Machtmissbrauch und Sexismus in Museen offensiv zu verhandeln. Sie schreibt: "Wenn wir die Debatte um (Macht-)Missbrauch in der Kunstwelt ernsthaft und nicht auf dem Niveau einer Massenkeilerei führen wollen, muss dieser auch in den Museen thematisiert werden. […] Wer dadurch die Autonomie der Kunst bedroht sieht, kann kein allzu großes Vertrauen in sie haben." Darüber hinaus gibt ihr Artikel einen guten Überblick über die unterschiedlichen Strategien, mit denen Ausstellungsinstitutionen auf die Debatte zu reagieren versuchen.
Das Museum als Schutzraum der Kunst ist ein beliebtes Narrativ. Die immer lauter werdenden Forderungen nach einer kritischen Einordnung auch von historischen Werken scheinen diesen Schutzraum in Frage zu stellen. Dass diese Vorstellung schon immer ein Trugschluss war, versucht Kia Vahland in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung zu belegen. Die Theorie des "männlichen Blicks", welche in den 70er Jahren entstanden sei, habe teilweise zu einer etwas undifferenzierten Perspektive auf die Kunstwerke vergangener Jahrhunderte geführt. "Zahllose Einzelanalysen klassischer Werke zeigen seither: Die besten Künstler stehen nicht automatisch auf Seiten der Starken. Im Gegenteil wagen viele es, diese immer wieder und besonders gerne im Sexuellen herauszufordern. Männer wie Tizian, Caravaggio, Donatello und andere waren viel zu unabhängige Geister, um sich den Wünschen und Lebenslügen ihrer Zeitgenossen zu beugen", so die Autorin. "Im Museum sind Untaten und Machtmissbrauch schon lange, wie heute bei 'Me Too', sag-und zeigbar. Es taugt nicht zur Selbstvergewisserung für Nostalgiker. Die Deutungshoheit einer kleinen männlichen Elite in Kunst- und Geschlechterfragen haben hier schon andere zunichte gemacht: die Künstler selbst." Gerne möchte man der Autorin glauben. Dennoch scheint hier eher, wie so oft, die Ausnahme die Regel zu bestätigen.
Das die Begegnung mit Kunst und gerade auch zeitgenössischer Kunst unbehaglich sein kann, darum dreht sich ein Essay des Kunstwissenschaftlers Christian Saehrendt, welchen die Neue Züricher Zeitung veröffentlicht hat. Das Gefühl der Scham und der Peinlichkeit sind für Saehrendt dabei von besonderem Interesse. Er schreibt: "Begegnungen mit Kunst und Künstlern, Gespräche über Kunst empfinden [viele Zeitgenossen] als belastend, weil sie eine Blamage fürchten. Es erscheint wie ein Paradox: Während es, im Vergleich zu den vergangenen Jahrhunderten, immer weniger verbindliche Regeln für das Benehmen und Zusammenleben zu geben scheint, während der Einzelne, befreit von Klassen- und Standesgrenzen, eigentlich immer weniger Angst davor haben müsste, gegen Regelwerke, Dresscodes und Sprachformeln zu verstossen, ist die Angst vor der Peinlichkeit proportional mit der persönlichen Freiheit gewachsen. Gerade im Umgang mit Kunst manifestiert sich eine tiefsitzende Angst, in Gesellschaft blossgestellt zu werden."
Kolja Reichert versucht sich in der FAZ an einer Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Kunst. Als Anlass dienen ihm dabei zwei sich zeitlich überschneidende Veranstaltungen: das Medienkunstfestival Transmediale in Berlin und die Feierlichkeiten zum Abschluss des "Rolex Mentor and Protégé"-Programm zur Unterstützung junger Künstler, die ebenfalls in der Bundeshauptstadt stattfanden. Reichert beschreibt beide als Extreme, die exemplarisch seien für den gegenwärtigen Zustand der zeitgenössischen Kunst: "Am einen [Pol] herrscht eine gewisse Ratlosigkeit, welche Rolle die Kunst in der Verteidigung individueller Freiheit spielen könnte, am anderen dient die Kunst als unter dem Einsatz horrender Summen von Geld geförderter Rohstoff für die erzählerische Aufwertung einer Luxusmarke. Beide Veranstaltungen zeugten davon, dass sich im Dreieck von Künstler, Werk und Gesellschaft gerade etwas grundlegend verschiebt."
Das strenge Nacktheitsverbot auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram macht auch vor künstlerischen Darstellungen nicht halt. Charlotte Bastam erläutert auf jetzt.de die Grundlagen des Konflikts. Eine ihrer Thesen: "Als amerikanisches Unternehmen führt Instagram somit lediglich die prüden Vorstellungen einer amerikanischen Mainstream-Gesellschaft aus. Zwar wird auch in Europa Nacktheit sexualisiert, doch bei weitem nicht so stark wie in den USA. Instagram überträgt durch die Anwendung dieser Regeln das Konzept einer „negativen Sexualität“ auf die europäische Gesellschaft."
Emily Elizabeth Goodman hat für hyperallergic.com eine Übersichtsschau der Street Art Künstlerin Swoon im US-amerikanischen Cincinnati Contemporary Arts Center besucht. Die Autorin kann sich durchaus für die Ästhetik der Arbeiten und das handwerkliche Geschick der Künstlerin begeistern, sie zeigt sich allerdings wenig erfreut über Swoons aktivistische Arbeit, innerhalb der sie mit „unterpriviligierten“ Minderheiten arbeitet und auf soziale Missstände hinweist: "In each of these projects, however, the temporary nature of her work in any one region makes it impossible for her to fully respond to the community’s needs. She lacks the lived experience to understand what these communities are actually struggling with and how they would, themselves, express it — and in many cases, since she works largely with communities of color, she can never access the lived experience. While she clearly attempts to empathize with them, she fails to amplify individual and community voices and instead translates their narratives into her own", so der Vorwurf der Autorin.
Die Berliner Galerie Aanant & Zoo schließt, zehn Jahre nach ihrer Gründung. Monopol hat mit Gründer Alexander Hahn gesprochen und ihn zu den Gründen befragt.
Am 12. Februar wurden die offiziellen Portraits von Michelle und Barack Obama der Öffentlichkeit vorgestellt. Während der ehemalige US-Präsident von Kehinde Wiley gemalt wurde, ließ sich seine Frau und ehemalige First Lady von Amy Sherald portraitieren. Der Tag der Enthüllung der Gemälde wurde von vielen als historisch bezeichnet, sind doch nun zum ersten Mal Portraits zweier Afroamerikaner Teil jener Gemäldesammlung geworden, welche alle ehemaligen US-Präsidenten und zum Teil auch deren Ehefrauen zeigt. Auch die beiden Künstler sind afroamerikanischer Abstammung – ebenfalls eine Premiere. Korrespondent David Smith berichtet für den Guardian über die Enthüllungszeremonie und die Entstehung der beiden Malereien.
Ebenfalls im Guardian analysiert Jonathan Jones die Portraits und macht gleich am Anfang deutlich, dass er die Darstellung Michelle Obamas für deutlich gelungener hält als die ihres Ehemannes. Wileys Gemälde sei zu referenziell und durchdacht und transportiere Barack Obamas Esprit nur unzureichend: „The artist has fitted Obama into a grid of stylistic jokes and art-history erudition, instead of capturing his essence. […] His painting is too rational, like a cold marble statue in a mausoleum. It will not tell future ages what made Obama special.“ Amy Sheralds Darstellung von Michelle Obama sei hingegen großartig gelungen: „Where Wiley freezes the president in the ice of authority, Sherald sets up her painting as a monument only in order to humanise and hearten it. […] The soft, poetic tones of Sherald’s painting are disarming and completely unexpected in a formal portrait.“
In ihrem Artikel für Hyperallergic.com hebt Chiquita Paschal die enorme historische und auch persönliche Bedeutung hervor, die die beiden Portraits für die schwarze Community und ganz besonders für schwarze Frauen hätten. Sie selbst habe als Afroamerikanerin ein zwiespältiges Gefühl gehabt angesichts der vielfältigen, auch kritischen Reaktionen auf das Portrait Michelle Obamas: „The thing is, I felt ambivalent about the painting. It was cool, aloof and mysterious. I wasn’t sure what to do with it. But because of the obstacle-strewn experience of black womanhood, I acutely appreciated the magnitude of the occasion, and felt compelled to support Michelle Obama and Amy Sherald — even if that meant giving up the opportunity for meaningful, critical dialogue.“ Es gebe eine gewisse Scheu unter schwarzen Frauen, sich gegenseitig öffentlich zu kritisieren angesichts vielfältiger Diskriminierungen, denen sie gemeinsam ausgesetzt seien.
Paschals Artikel stellt ein fast schon exemplarisches Beispiel dar für eine Form der Kunstkritik, die überwiegend aus einer identitätspolitischen Perspektive heraus argumentiert.