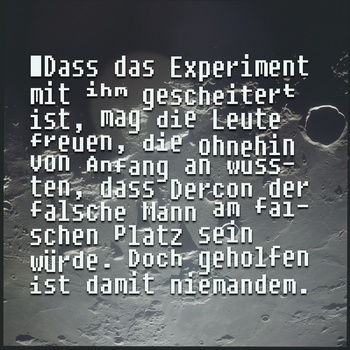
Das Zitat stammt aus einem Artikel von Dirk Peitz über den Rücktritt Chris Dercons vom Posten des Chefintendanten an der Berliner Volksbühne, veröffentlicht auf Zeit Online am 13.04.2018.
Seit letzter Woche ist klar: Chris Dercon gibt auf. Der belgische Kurator tritt von seinem Posten als Intendant der Berliner Volksbühne mit sofortiger Wirkung zurück, wie am vergangenen Freitag bekannt wurde. Kultursenator Klaus Lederer und Dercon hätten sich einvernehmlich auf diesen Schritt geeinigt, hieß es. "Beide Parteien sind übereingekommen, dass das Konzept von Chris Dercon nicht wie erhofft aufgegangen ist, und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht", so der Wortlaut der gemeinsamen Erklärung. Die Nominierung Dercons zum Nachfolger Frank Castorfs hatte für beispiellosen Streit in der Berliner Kulturlandschaft und weit darüber hinaus gesorgt, entsprechend zahlreich sind die Kommentare zu dessen frühzeitigen Rücktritt.
Georg Diez versucht auf Spiegel Online Gründe zu finden für die große Emotionalität, mit der die Personalie Dercon verknüpft war. Die fünfundzwanzigjährige Ära Castorfs sei extrem verklärt worden: "Es ging um ein Berlin, das war, das in der Erinnerung lebte, das nicht vergehen sollte, es ging um ein identitätsstiftendes Kunstprojekt, das in den Neunzigerjahren begonnen hatte und ewig dauern sollte für eine Generation, die mit ihrer eigenen Jugend alt werden will." Im Streit um die Volksbühne erkennt Dietz ein bekanntes Muster - die Selbstzerfleischung der politischen Linken: "Und das ist vielleicht das größte Versagen der vergangenen Jahre, es ist nicht künstlerischer, es ist politischer Art, und es ist nicht Dercons Schuld, sondern eher die seiner Gegner: Während die Gesellschaft kippte, verloren sich die, die gegen dieses Kippen hätten arbeiten können, in Schlachten untereinander."
Ebenfalls auf Spiegel Online stellt sich Wolfgang Höbel die Frage, wer eigentlich Schuld sei am Scheitern Dercons, die Berliner Kulturwelt oder der Intendant selbst. "Unbedingt beide", so die Antwort Höbels: "Statt seine Programmpläne wenigstens anzuhören oder vielleicht sogar die ersten Arbeiten an seinem Haus zu begutachten, wurde Dercon von vielen Medienmenschen und Lautsprechern des Berliner Kulturlebens gleich nach seiner Bestellung denunziert: als Vertreter einer globalen Kunstschickeria und als Mann der 'Eventkultur', wie es der im Berliner Ensemble abgetretene Theaterchef Claus Peymann formulierte." Allerdings sei sein Programm tatsächlich eher dürftig ausgefallen, so die Einschätzung Höbels. Aus seiner Sicht sei Dercon allerdings in allererster Linie an der Berliner Politik gescheitert. Berlins Bürgermeister Michael Müller, welcher maßgeblich an Dercons Berufung beteiligt war, habe ihm kaum politische Unterstützung zukommen lassen. Der seit 2016 amtierende Kultursenator Lederer sei sogar ein ausgewiesener Gegner Dercons gewesen. Enttäuschend sei der Weggang Dercons für viele jüngere Menschen, so Höbel: "Neben Matthias Lilienthal, der seit 2015 die Münchner Kammerspiele leitet, galt Dercon trotz aller Anfeindungen als Symbolfigur des Theaterfortschritts. Ähnlich wie Lilienthal plädiert Dercon - in seinem Fall leider in oft hochtrabenden Worten - für ein Theater, das sich als Ort des Crossovers zwischen verschiedenen Kunstgenres und als Stätte des politischen Diskurses versteht; für eine in tendenziell gelockerten Arbeitsstrukturen stattfindende Beschäftigung mit den Mitteln von Performance, Film, Musik und intellektueller Sozialarbeit."
In seinem munteren Kommentar zum Fall Dercon beschreibt Mladen Gladić im Freitag die Atmosphäre im Berliner Kulturbetrieb als eine, die von Anfang an von Angst geprägt gewesen sei: "Angst vor'einer global verbreiteten Konsenskultur mit einheitlichen Darstellungs- und Verkaufsmustern' jedenfalls, auch Angst davor, dass es mit dem neuen Intendanten zu Stellenkürzungen kommen würde." Gladić spekuliert über eine Rückkehr Castorfs als eine Art Theaterversion Berlusconis, dem Stehaufmännchen der italienischen Politik, und plädiert für eine Versachlichung der leicht übergeschnappten Debatte der letzten knapp drei Jahre, denn: "Es ging und geht um eins von etwa 140 öffentlich getragenen Theatern in Deutschland, in einer Stadt, die zufällig Berlin heißt."
In der Zeit ruft Dirk Peitz noch einmal die Anfänge der Dercon-Streitigkeiten ins Gedächtnis, welche ja mit dem Auslaufen von Frank Castorfs Vertrag im Jahre 2015 ihren Anfang nahmen: "Castorf […] fühlte sich offenbar zutiefst gekränkt und fürchtete wohl (im Nachhinein nicht zu Unrecht), dass mit der Entscheidung für Dercon ein Bruch mit der von Castorf begründeten Volksbühnen-Ästhetik seit den Neunzigerjahren gewollt war." Es folgt eine kurze Chronologie der Ereignisse bis zum tatsächlichen Programmstart der nun von Dercon geleiteten Volksbühne Ende des Jahres 2017. Dercons Gesamtkonzept sei kaum zu begreifen, so unterschiedlich seien die Formate: "Gäbe es nicht das alte Jugendtheater P14 des Hauses, dann würde an manchen Abenden in der Volksbühne nur noch diskutiert, vorgelesen, getanzt, Musik gemacht oder im recht universellen Sinne performt. […] Wenn man freundlich sein möchte, kann man hinter der völligen Offenheit der neuen Volksbühne gegenüber jeglicher Form von Darbietung einen zeitgenössischen Plattformgedanken vermuten. Man kann das Programm aber auch für total erratisch halten." Gewonnen habe mit dem nun verkündeten Rücktritt Dercons niemand: "Dass das Experiment mit ihm gescheitert ist, mag die Leute freuen, die ohnehin von Anfang an wussten, dass Dercon der falsche Mann am falschen Platz sein würde. Doch geholfen ist damit niemandem."
Einen wirklich schönen und versöhnlichen Nachruf hat Robin Detje ebenfalls in der Zeit veröffentlicht. Dercon habe nie eine faire Chance bekommen, so der Tenor seines Artikels. Detje beklagt eine sinnlose Polarisierung innerhalb der Künste, die im Streit um Dercons Intendanz zum Vorschein kam: "Der Umsturz von oben war ein Umsturz mit Ansage. Zu seinem ganzen Irrwitz gehört, dass dabei im Berliner Kampfgetümmel auch die Solidarität von Künstlern untereinander ausgesetzt wurde. Plötzlich gab es böse Kunst (bildende Kunst, Kuratorenkunst), und gute Kunst (deutsche Stadttheaterkunst, Avantgarde im Rahmen klarer Verwaltungsvorschriften). Dercon hat das Repertoiretheater infrage gestellt, er war ein Systemfeind, also war er auch Volksfeind, denn das System dient dem Volk und schützt es vor einer Kuratorenkunst, in deren Windschatten nichts anderes in die Stadt einziehen würde als Hyperinvestoren, die Glaspaläste für Superreiche bauen. Ein ausgesprochener Schwachsinn natürlich, ein Wahn, der sich nur aus der allgemeinen Stimmung im Land erklären lässt, dem neuen Hang zur Ehrerbietung gegenüber verdienten alten Männern und 'gewachsenen Strukturen', dem Wiederaufleben eines autoritären Paternalismus."
Susanne Messmer beschreibt die Berufung Dercons in ihrem Artikel für die TAZ als eine einsame "Schnapsidee" des damaligen Kultursenators Tim Renner, die von vorne herein zum Scheitern verurteilt war: "Einer Schnapsidee eines Musikproduzenten, den es damals wie aus Versehen für die SPD ins Amt des Berliner Staatssekretärs für Kultur verschlagen hatte. Tim Renner hatte sich im März 2015 überlegt, man könnte auch einen international renommierten Museumschef als neuen Intendanten der Berliner Volksbühne berufen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, ebenfalls SPD und damals nebenher auch noch Kultursenator, hatte nichts gegen Chris Dercon, den Leiter der Tate Modern in London – und so kam es zu jener einsamen Entscheidung der Berliner Kulturpolitik, die einfach der Stadt übergestülpt wurde und die heute kein Mensch mehr nachvollziehen kann." Die fehlende Unterstützung Dercons durch die Berliner Politik habe dann ihr Übriges getan.
Kommen wir zum geschäftlichen Teil.
Wie Streetart-Star Banksy sein Geld verdient, versucht Loney Abrams für artspace.com zu klären. Auf den ersten Blick sei das eine durchaus rätselhafte Angelegenheit, schließlich arbeite der Künstler anonym im öffentlichen Raum und verdiene nichts am Verkauf seiner Arbeiten, welche häufig abgetragen und auf Auktionen veräußert werden würden. Die Recherche des Autors gibt interessante Einblicke in die speziellen Wertschöpfungsstrukturen des Kunstmarktes und legt zudem jene Widersprüche offen, die die Kommodifizierung einer scheinbar wiederständigen und authentischen Ausdrucksform wie der Streetart mit sich bringen.
"Is a gallery’s homepage more important than its storefront?" fragt Taylor Dafoe auf news.artnet.com. Die Besucherzahlen in den physischen Niederlassungen von Kunstgalerien würden zurückgehen, gleichzeitig steige die Bedeutung des Internets für die Knüpfung neuer Kontakte und für die Gewinnung neuer Sammlerschichten. Dafoe befragte zahlreiche Galerien zu ihren Online-Strategien und stellt diese kurz vor. Den New Yorker Galeristen Sean Kelly zitiert er mit folgenden Worten: "I don’t think the digital is going to replace the in-person anytime soon. [...] But the ways in which sales conversations are initiated—that’s where we’ll continue to see a significant difference."
Die traditionsreiche Postmasters Galerie aus New York steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nun hat Gründerin Magda Sawon eine neue Finanzierungsstrategie angekündigt: Durch die Unterstützung von sogenannten "Patreons", welche einen monatlichen Betrag zwischen 3$ und 500$ zahlen können, soll die Galerie unabhängiger werden vom reinen Kunstverkauf. Als Gegenleistung erhalten Unterstützer folgendes: "$3 a month will get your name on the gallery’s patron wall; $6 for early access information and invites; $25 for special viewings; $100 for a biannual one-hour 'ask us anything' lunch or Skype meeting; and $500 for a two-hour biannual meeting." Sawons persönliche Auffassung von Galeriearbeit ist äußerst sympatisch. Gegenüber news.artnet.com sagte sie: "I am a populist, I always have been," she says. "Nobody really discusses audience—diverse people of all walks of life that come to galleries without an intent to buy art. I love these folks. They are not a nuisance. They are extraordinarily important. And so I am hoping we are important to them too."
Das Brooklyn Museum in New York hat mit Kristen Windmuller-Luna eine weiße Frau zur Kuratorin für Afrikanische Kunst berufen. Nun regt sich öffentlicher Widerstand gegen die Entscheidung; In einem offenen Brief wird eine Kommission zur "Dekolonisierung" des Museums gefordert. Hrag Vartanian bespricht in seinem Artikel für Hyperallergic.com die Hintergründe der Kontroverse.
Im deutschsprachigen Raum scheint mir die Neue Züricher Zeitung einer der wenigen publizistischen Orte zu sein, an dem eine eher konservativ gefärbte Kunst- und Kulturkritik stattfindet. Ein gutes Beispiel wäre Christian Saehrendts Klage über den "Bildersturm der Beleidigten", den er in einem Anfang des Monats publizierten Artikel anprangert. "Selbsternannte Minderheiten-Aktivisten kultivieren eine neue Kunstfeindlichkeit", so lautet dessen programmatische Überschrift.
Nun hat Gabriele Detterer - ebenfalls in der NZZ - einen Artikel über die Bedeutung des Hässlichen, Monströsen und Geschmacklosen in der zeitgenössischen Kunst veröffentlicht. Sie diagnostiziert gleich zu Beginn eine breite gesellschaftliche Akzeptanz eben jener Erscheinungsformen, welche von der Autorin im Folgenden ausführlich kritisiert werden: "Man kann den Drang zum Geschmacklosen als Folge des Zerfalls eines historischen, an Ethik gebundenen Wertekanons sehen und als Ausdruck von Unsicherheit und Desorientierung. Zudem funktioniert Hässlichkeit als Strategie, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Shock sells! Das befriedigt eine Ichbezogenheit, welche die Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer nicht kennt." Jenes "Anything goes" wird von der Autorin als Zeichen zivilisatorischen Niedergangs interpretiert: "Schlampig gemachte Installationskunst, die aus zusammengebastelten Referenzen auf Vergangenheit besteht, und allerlei Absonderliches in der Malerei fädeln sich ein in das Credo 'Alles ist möglich'. Diese Offenheit blendet viele. Doch 'unbegrenzte Beeindruckbarkeit' und ein 'überallhin offenes Verstehen' nannte bereits Georg Simmel als Kennzeichen von Kulturgesellschaften im Niedergang. Hemmungslos würde Dekadenz all dasjenige zusammenknüpfen, was eigentlich auseinanderstrebe, konstatierte der Soziologe."
Detterer beruft sich in ihrem Artikel unter anderem auf den Maler und Bildhauer Baselitz, dessen Werk voller Hässlichkeit und grotesker Momente und eben auch extrem populär sei. Interessant ist hier der Artikel von Annekathrin Kohout über das Hässliche in der Arbeit eben jenes Künstlers und die rhetorische Figur des "hässlichen Deutschen". In ihrem Blogpost auf sofrischsogut.com zitiert sie Baselitz, der in einem Künstlergespräch die Hässlichkeit seiner Arbeit immer wieder selbst betonte. Sie schreibt: "Um das 'Hässliche' zu verstehen, muss man gebildet sein und 'anders' denken. 'Hässlich' ist – im Sinne von Nonkonformität – positiv besetzt und wird, so meine Annahme, von Baselitz zur Aufwertung verwendet."
Politisch motivierte Kunstaktionen kommen fast ausschließlich aus der linken Ecke des politischen Spektrums. Nun hat ein Verein aus dem Pegida-Umfeld die Skulptur eines Trojanischen Pferdes vor dem Dresdner Kulturpalast aufgestellt. Michael Bartsch berichtet für die TAZ über die Hintergründe der Aktion.
In der Fondazione Prada in Mailand hat eine großangelegte Ausstellung über die Kunst des italienischen Faschismus eröffnet. In seinem wirklich interessanten und ausführlichen Artikel für die FAZ blickt Kolja Reichert auf jene Epoche zurück, in der politischer Totalitarismus mit einer ungeahnten Blüte der Kunst zusammenfiel: "Das ist immer noch verblüffend: Baut, wer heute einen autoritären Staat errichtet, auf Gleichschaltung und Senkung des Niveaus, so baute das faschistische Italien zumindest offiziell auf Hebung des Niveaus durch maximale Partizipation. Und so kommt es, dass in der Kunst des italienischen Faschismus, ganz anders als in ihrer käsigen, kleingeistig-verspannten deutschen Variante, alles nebeneinander existierte: Konstruktivistisches von Mario Radice oder Gino Ghiringhelli; Neue Sachlichkeit von Mario Sironi; die meditative Innerlichkeit Morandis; Adolfo Wildts geschwollene Skulpturen, die immer wirken, als fühlten sie sich in ihrer Marmorhaut nicht wohl; antikisierende Berauschungskunst in den immer pompöseren Wandmalereien; und natürlich der Futurismus, wie im Sondergenre der aeropittura, der Flugzeugmalerei, die in Italien mit der Aufrüstung blühte."